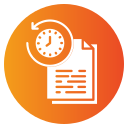Parallele Wege: Historische Stadtplanung in Deutschland
Die Entwicklung deutscher Städte war schon immer von einem fein abgestimmten Zusammenspiel unterschiedlicher Einflüsse geprägt. Die Geschichte der Stadtplanung in Deutschland zeigt eindrucksvoll, wie sich verschiedene Ansätze und Konzepte oftmals parallel entwickelten, teils voneinander inspiriert, teils deutlich voneinander abgegrenzt. Ob mittelalterliche Handelszentren, barocke Idealstädte oder die Neukonzeptionen des Industriezeitalters – stets spiegeln sich in der Stadtstruktur die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen ihrer Zeit wider. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die prägenden Etappen der historischen Stadtplanung in Deutschland, erkunden parallele Entwicklungen und beleuchten, wie sich diese bis heute im Stadtbild manifestieren.
Frühe Stadtgründungen und mittelalterliche Siedlungsformen
Handelsrouten als Impulsgeber
Kirchliche Einflussnahme auf den Städtebau
Festungen und Stadtmauern